In der Schweiz wird das Steuerrecht nach dem Prinzip der Familienbesteuerung geregelt. Doch häufig gehören nicht alle Familienmitglieder derselben Religionsgemeinschaft an, was zu gemischtkonfessionellen Ehen führt. Manchmal ist auch ein Familienmitglied nicht gläubig oder gehört keiner offiziell anerkannten Religion des Kantons an.
Die meisten Kantone berücksichtigen diese Vielfalt und haben spezifische Regelungen zur Aufteilung der Kirchensteuer. Einige Kantone ziehen dabei auch die Kinder in Betracht:
► In Kantonen wie Zürich, Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Tessin, Wallis und Genf wird der halbe Steuersatz der jeweiligen Konfession des betreffenden Ehepartners oder eingetragenen Partners angewendet, unabhängig von den Kindern.
► Andere Kantone wie Bern, Appenzell Innerrhoden und Jura wenden den vollen Steuersatz an, jedoch auf die Hälfte der geschuldeten Steuer, auch wenn Kinder vorhanden sind.
► In den Kantonen Glarus und St. Gallen kann auf Antrag des Steuerpflichtigen (mit Kindern) die Aufteilung nach Köpfen erfolgen.
► In den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Aargau und Neuenburg wird der halbe Steuersatz der jeweiligen Konfession des betreffenden Ehepartners angewendet, aber bei Familien mit Kindern erfolgt eine proportionale Aufteilung des Steuersatzes oder -anteils unter Berücksichtigung der Kinder und ihrer Konfession.
► In den Kantonen Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft und Schaffhausen wird die Kirchensteuer je nach Hälfte des Gesamteinkommens erhoben. Dabei ist die religiöse Zugehörigkeit minderjähriger Kinder unerheblich.
In all diesen Kantonen (ausser im Kanton Uri, der eine Flat Rate Tax anwendet und den "halben Satz" daher nicht kennt) wird, wenn ein Ehepartner oder eingetragener Partner einer anerkannten Religionsgemeinschaft nicht oder nicht mehr angehört, nur sein Partner, und zwar zum Satz (oder halben Satz) seiner Konfession, besteuert.
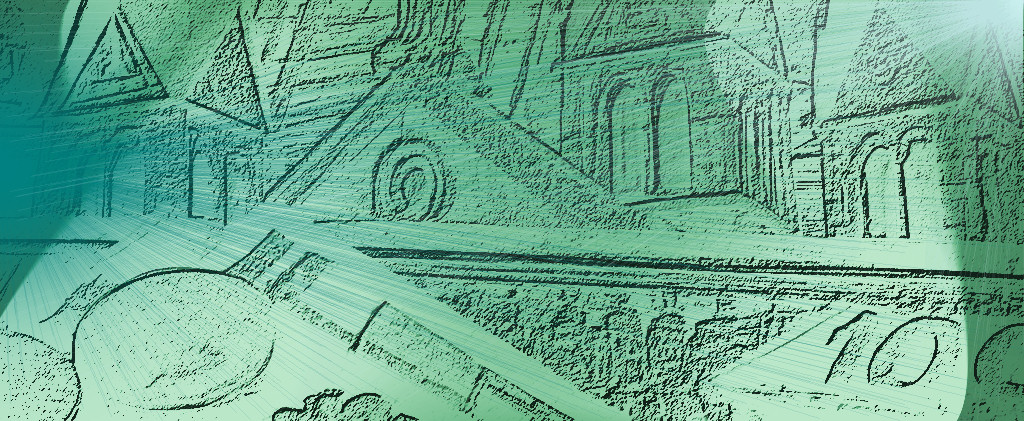
Die Folge können zu speziellen Situationen führen, beispielsweise wurde diese Konstellation in Basel angefochten: Während die konfessionslose Ehefrau praktisch das gesamte Haushaltseinkommen verdient, wurden von diesem Haushaltseinkommen trotz Kirchenaustritt zwei Drittel der vollen Kirchensteuer an die evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt bezahlt für die Konfessionsgehörigkeit von Ehemann und Kind. Im Fall dieser Familie aus Basel wurde argumentiert, dass es gegen die Religionsfreiheit verstosse, wenn das Erwerbseinkommen der konfessionslosen Person für die Kirchensteuer (und in Basel sind die Kirchensteuern aussergewöhnlich hoch) verwendet werden müsse.
In letzter Instanz entschied das Bundesgericht zu diesem Fall aus Basel: Bei konfessionell gemischten Ehen ist derjenige Ehegatte Steuersubjekt, welcher der jeweiligen Konfession angehört, für die die Kirchensteuer erhoben wird. Es verstösst nicht gegen Verfassungsrecht, wenn bei der Steuerbemessung auf das Einkommen beider Ehegatten abgestellt wird (Faktorenaddition), sofern der unterschiedlichen Religionszugehörigkeit dadurch Rechnung getragen wird, dass nur ein Bruchteil der vollen Kirchensteuer erhoben wird.